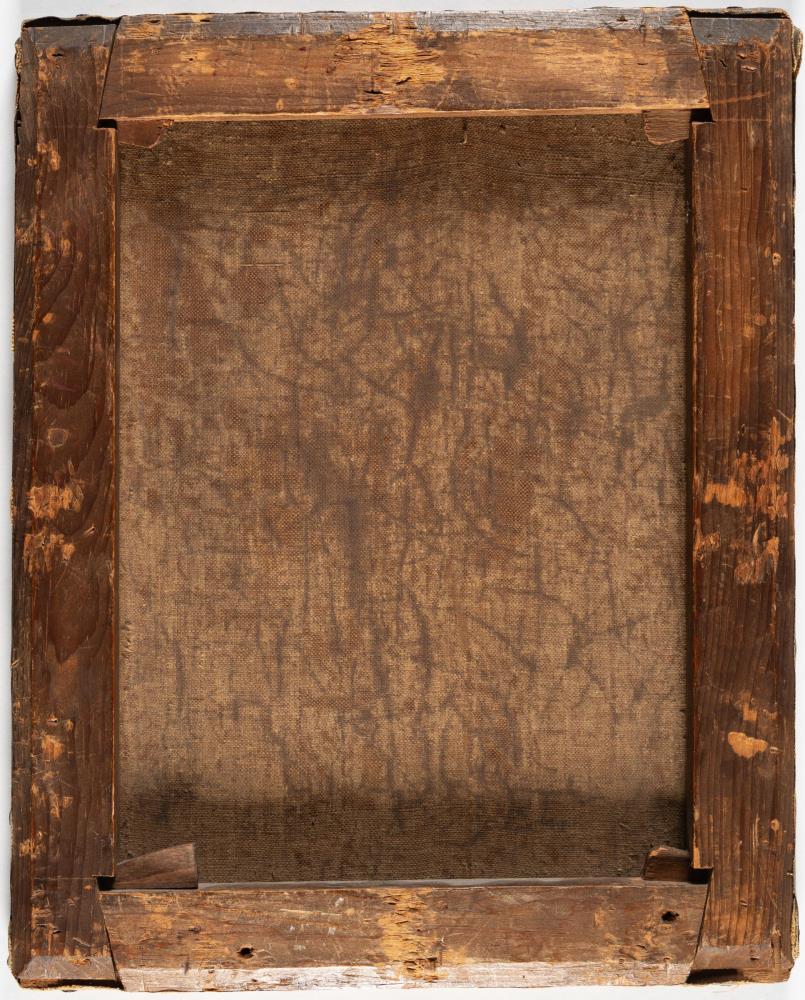Carl Spitzweg
Der verbotene Weg
Beschreibung
1920 hatte ein heute vergessener Stummfilm von Henrik Galeen Premiere, der unter demselben Titel wie unser Gemälde erschien: Der verbotene Weg, in dem der Protagonist des Films, ein niederländischer Amtmann, auf eheliche Abwege gerät, weil er an der Gastwirtsgattin Susanne Gefallen findet. Um seinen lästigen Nebenbuhler aus dem Feld zu schlagen, lässt der Amtmann den Gatten unter fadenscheinigen Anschuldigungen verhaften und einkerkern. Der Gastwirt bricht aber aus seiner Zelle aus und Susanne befreit sich aus den Fängen des Amtmanns, was für diesen zur Folge hat, dass er zweimal ordentlich Prügel bezieht – von dem hintergangenem Gastwirt und von seiner eigenen Gattin.
Galeens Komödie war nur mäßig erfolgreich und zumindest Letzteres können wir für den Protagonisten unseres Bildes ausschließen – er gehört dem geistlichen Stande an, doch auch er steht an einem Punkt, an dem er gewissermaßen in Versuchung geführt wird. Der Priester – ein Jesuit - hat seinem Spaziergang in einer Voralpenlandschaft mit dem Lesen in einem Buch, wohl einem Brevier, Sinn gegeben, hat Texte für das Stundengebet studiert, doch jetzt hat er seine Lektüre unterbrochen, hält das aufgeschlagene Brevier in seinen auf dem Rücken verschränkten Händen. Er ist auf seinem Weg an einer Schranke angekommen, ein zwischen zwei Pfosten befestigter Knüppel versperrt ihm den Weg – ein von einem Kornfeld und Weinranken gesäumter Weg, doch wohin führt er? Ein an einer gewundenen, hoch aufragenden Stange befestigtes Schild warnt ihn mit dem Hinweis, dass dieser Weg verboten sei. Das titelgebende Schild ragt steil hervor wie ein Kreuz, hält den Priester davon ab, den falschen Weg zu betreten, wo jenseits der Schranke ein Soldat mit Husarenkappe und eine Dame in das Kornfeld getreten sind. Sie haben sich zu einem Stelldichein getroffen, um zu sehen wie sich das zarte Pflänzchen der Liebe entwickelt. Dieser Weg ist dem Priester verwehrt, doch er ist im Zweifel, ist am Überlegen, wie es wäre, diese Grenze zu überwinden, möglicherweise sogar dem Paar zu folgen und es zu belauschen. Wir wissen es nicht, wie sich der Priester entscheidet, doch ganz offensichtlich steht er wie früher im antiken Mythos Herkules am Scheideweg, der sich zwischen Tugend und Laster entscheiden musste – der Priester hält genau da inne, wo von dem ihm verwehrten Weg ein kleiner Pfad abzweigt, der in ein Dorf und seiner Kirche mit den hoch aufragenden Doppeltürmen führt. Er muss sich entscheiden, ob er zu seiner Kirche abbiegt oder eine Grenzüberschreitung begeht und sich in Regionen, und sei es nur gedanklich, begibt, die ihm eigentlich verwehrt sind.
Spitzweg lässt offen, wie sich der Priester entscheidet, ob er vom „rechten“ Weg abkommt oder in den Schoß seiner Kirche zurückkehrt. Als große, das Bild beherrschende Rückenfigur, dieser großartigen Erfindung der Romantik, ist er allein mit seiner Entscheidung, auch findet er keinen Kontakt zum Betrachter, von dem er sich abgewendet hat. Er ist auf sich allein gestellt genauso wie der Betrachter, der sich fragen muss, wie er sich denn entschieden hätte.
1850 erschien in Wien die Erzählung „Der verbotene Weg“, die der Autor Joseph Heilmann im Untertitel als Erzählung aus dem österreichischen Landleben für die Jugend inhaltlich genauer definiert. Im Laufe der Erzählung erfahren die Kinder über die Bedeutung von Gemeinschaft und Familie, werden mit den Anforderungen eines Gerechten und gottgefälligen, tugendhaften Lebens bekannt gemacht. Es ist eine erzählerische Anleitung in Moral und Sittlichkeit – wir wissen nicht, ob Spitzweg, der ja selbst viel las, diese kleine Schrift kannte, es dürfte sogar eher unwahrscheinlich sein, doch zeigt sie, wie das Thema von Moral und Tugend, die Frage nach einem redlichen und aufrichtigen Leben allgemein vor allem das aufstrebende Bürgertum in dieser Umbruchzeit des 19. Jahrhunderts beschäftigt hat. In seinen Gemälden thematisiert Spitzweg immer wieder den Konflikt zwischen Moral und Unmoral, zwischen der Freiheit der Gedanken und der Erfüllung gesellschaftlicher Normen. Er hält der Gesellschaft den Spiegel vor, dabei stets liebevoll, doch auch ironisch auf Außenseiter der Gesellschaft zielend, wozu in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft auch der Stand der Geistlichkeit zählte. Landpfarrer und Dorfpfarrer bevölkern ihr Brevier lesend Spitzwegs Landschaften, beobachtet sie auf ihrem Spaziergang, Mönche haben sich in einsame Waldklausen und Eremitagen zurückgezogen, weil ihre Klöster nicht mehr existieren – und immer sind sie allein. Es ist die Erzählung von der beginnenden Vereinzelung in der Gesellschaft, die später in der Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine große Rolle spielen sollte. Das Thema war begehrt und Spitzweg war damit sehr erfolgreich; Siegfried Wichmann führt in seinem Werkverzeichnis nicht weniger als sieben Fassungen unserer Bilderfindung auf (Nr. 274-280).
Diese großen Fragen gesellschaftlicher Konflikte und Auseinandersetzungen hat Spitzweg häufig in der Gattung Landschaft verhandelt – auch hier ist es eine Voralpenlandschaft wie sie der Maler von seinen zahlreichen Ausflügen und Wanderungen kannte. Wahrscheinlich geht auch unsere Landschaft auf eine reale Begegnung zurück, denn bei der Kirche rechts könnte es sich um Sankt Tertulin in Schlehdorf am Kochelsee handeln. In pastoser Malerei schildert Spitzweg besonders vorne den Wiesengrund mit großer Detailgenauigkeit – Gräser, Blumen, Steine, der erdige Weg werden genau beobachtet, und man meint als Betrachter, beinahe in dem aufgeschlagenen Brevier lesen zu können. Und dann das warme Licht, das auf die Kornähren und den Wein fällt, der am rechten Pfosten in die Höhe rankt. Das alles ist in die Stimmung eines wolkenverhangenen, vergehenden Tages eingebettet, in dem sich das auf der anderen Seite befindliche Paar dem Abendrot nähert, während der Priester allein zurückbleibt.
Dr. Peter Prange
Mit O.-Gutachten von H. Uhde-Bernays, Starnberg, vom 14.9.1960 und von E. Hanfstaengl, München, vom 20.12.1962, sowie jeweils mit der Abschrift.